Bis zur Oscarnominierung von Bill Nighy für die beste männliche Hauptrolle hatte ich diesen Film nicht auf dem Schirm. Zu meiner Schande muss ich sogar gestehen, dass mir nicht einmal das japanische Original Ikiru von Akira Kurosawa von 1952 geläufig war. Leider gibt es heute auch nicht mehr viele Möglichkeiten, diese alten Meisterwerke nachzuholen. Aktuell befindet er sich lediglich im Programm der Schweizer Arthaus-Streamingplattform Filmingo, von der ich zuvor noch nie gehört habe.
Vor zwei Wochen ist Living, dessen deutscher Untertitel Einmal wirklich leben gleichzeitig der deutsche Titel von Ikiru ist, in unseren Kinos gestartet, und wer die Möglichkeit hat, sich ihn anzuschauen, sollte sie ergreifen. Es lohnt sich.
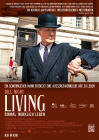
Living – Einmal wirklich leben
Mr. Williams (Bill Nighy) ist ein stiller, gewissenhafter Abteilungsleiter im Londoner Bauamt. Als der junge Peter Wakeling (Alex Sharpe) neu zu der Gruppe stößt, lernt er bald, dass sein Chef wenig Humor hat und sich stets korrekt, aber auch distanziert verhält. Vorgänge werden an andere Abteilungen weitergeleitet, aufgeschoben oder widerstrebend bearbeitet. Man erweckt stets den Eindruck beflissener Geschäftigkeit, aber im lärmenden Getriebe der Bürokratie herrscht eher lähmender Stillstand. Für Mr. Williams ändert sich alles, als er eines Tages eine niederschmetternde Krebsdiagnose bekommt, und er erkennt, dass er sein Leben weitgehend vergeudet hat. Der Alltagstrott hat ihn komplett vereinnahmt, zu seinem Sohn (Barney Fishwick) hat er ein emotional unterkühltes Verhältnis, das es ihm nicht einmal erlaubt, ihm die Wahrheit über seine Krankheit zu sagen. Verzweifelt erkennt Mr. Williams seine vollkommene Einsamkeit.
Filme über todkranke oder sterbende Menschen sind keine Seltenheit, aber in der Regel sind sie eher bedrückend als unterhaltsam. Die Beschäftigung mit den großen, den letzten Fragen ist künstlerisch sicherlich interessant und emotional lohnend, aber nur wenigen Filmen gelingt dies mit leichter Hand. Die meisten davon sind vermutlich britisch.
Living beginnt zunächst wie eine Bürokratie-Posse, die überaus amüsant ist. Mit Wakeling wird auch der Zuschauer mit in diese mitunter bizarre Welt der britischen Bürokratie des Jahres 1953 genommen, die auch Terry Gilliam in Brazil so herrlich durch den Kakao gezogen hat. Für einige Frauen aus dem Londoner East End, die für einen neuen Spielplatz auf dem Gelände einer Kriegsruine kämpfen, ist der Gang durch das Labyrinth der County Hall allerdings alles andere als amüsant. Sie kämpfen wie Don Quichotte vergeblich gegen die Windmühlen der Beamten, die sich grundsätzlich für nichts verantwortlich fühlen, aber stets genau wissen, dass es ihr Kollege in einer anderen Abteilung ist.
Mit Mr. Williams Diagnose fokussiert sich der Film endgültig auf eine Figur, die bislang eher am Rande eine Rolle gespielt hat, und findet dabei sein emotionales Zentrum. Wobei die unterkühlte britische Natur und das gelassene Understatement es schwer machen, irgendwelche Emotionen zu entdecken. Umso bemerkenswerter ist Bill Nighys subtiles Mienenspiel, das genau erkennen lässt, welche Qualen er leidet, in welche Abgründe er blickt. Das ist große Schauspielkunst.
Leider beginnt mit Mr. Williams emotionaler Erschütterung angesichts des drohenden Todes auch ein Abschnitt im Film, der episodisch zersplittert und weitgehend redundant ist. Man würde bei einem Mann wie Mr. Williams (der über keinen Vornamen zu verfügen scheint) annehmen, dass er einfach so weitermacht wie bisher, doch stattdessen bricht er aus, fährt an die See, denkt an Selbstmord und findet für eine Nacht Trost im Alkohol. Seinen Schmerz sublimiert er in einer melancholischen schottischen Ballade, die als musikalisches Leitmotiv immer wiederkehrt. Überhaupt sind der Soundtrack und die Filmmusik von Emilie Levienaise-Farrouch wunderschön und ungemein passend.
Nach einigen kleineren Längen, die allerdings zu keiner Zeit wirklich langweilig oder uninteressant sind, nur eben nicht viel Neues zu Mr. Williams’ Schicksal beizutragen haben, macht die Handlung einen gewagten Zeitsprung hin zum unvermeidlichen Ende, um dann den dritten Akt in Rückblenden zu erzählen. Durch diesen Kniff hat der Drehbuchautor und bekannte Schriftsteller Kazuo Ishiguro die Möglichkeit, ein wenig Spannung aufzubauen und Mr. Williams aus anderen Perspektiven zu zeigen.
Es ist vor allem dieses letzte Drittel, das den Film absolut sehenswert macht. Wie Mr. Williams am Ende noch einen Sinn in seinem Leben entdeckt und seinen Frieden findet ist meisterhaft und anrührend erzählt, mit viel Sinn für Schönheit und Poesie. Und jenem Augenzwinkern, das dem britischen Kino zu eigen ist, das man aber schon lange nicht mehr gesehen hat.
Regisseur Oliver Hermanus ist mit Living – Einmal wirklich leben ein stilles, unaufdringliches, aber ungemein schönes Meisterwerk gelungen, leider nicht ohne Schwächen, aber dafür mit überraschend viel Humor und Herzenswärme erzählt. Erfreulich ist auch, dass es endlich wieder einmal einen historischen Film gibt, der die Zeit, in der er spielt, korrekt wiedergibt und sich keine an die Moderne oder den Zeitgeist anbiedernden Brüche erlaubt. Kleidung, Frisuren, die Sprache und selbst das Bildformat wurden an die frühen Fünfziger angepasst, und das ist heutzutage keine Selbstverständlichkeit mehr.
Note: 2

